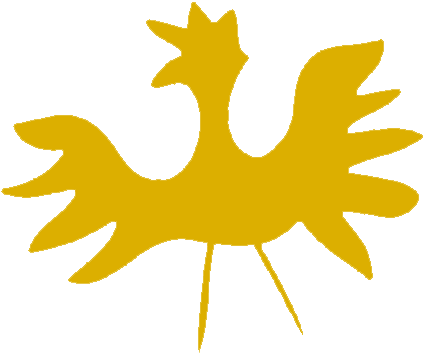Aus: Horst Schreiber, Im Namen der Ordnung
St. Martin in Schwaz 1958–1961: „Ich wurde zum Jasager erzogen.“
„Festsaal mit Wachs auf den Knien einlassen, geglänzt wie ein Spiegel, so wurde überall geputzt; Hofverbot, Sprechverbot, Karzer 1 Woche, putzen putzen waschen, die Heimkleider nähen, zu fremden Leuten putzen gehen; Kartoffel klauben und säen; Karzer, Ohrfeigen; Verbot zu meiner Schwester ins Krankenhaus zu gehen; still sitzen, Schweigen im Schlafsaal, ständige Spindkontrolle, sticken, Fenster mit Gitter, alles zugesperrt; man hat meine Schwester und mich total gebrochen! Alle dieselben Kleider, jeder wusste, dass wir Zöglinge sind. Unser Vergehen war, dass wir gerne und gut Rock and Roll getanzt haben. Meine Mutter wollte immer Vorzeigekinder, aber wir wollten nur ein bisschen Leben. Wir hatten weder Eislaufschuhe noch sonst irgendetwas. Bis heute bin ich ein Jasager. Habe immer Albträume, weine oft und alleine. Habe nie einen Ansprechpartner. Nach dem Heimaufenthalt in die Fabrik arbeiten gegangen. Zimmer mit offenem Klo und Ziehbrunnen im Keller, das war nach dem Heimaufenthalt unser zu Hause. So ist mein Leben weiter verlaufen, einfach Scheiße. Seit meinem 25. Lebensjahr Magenschmerzen, Wut- und Weinkrämpfe, Schlafstörungen sind normal. (...) Pubertierende Kinder waren wir, das ist alles. Von den anderen Kindern und besonders von der Schwester isoliert.“
Roswitha Lechner ist nervös und angespannt. Kurz vor dem Interview hat sie eine Beruhigungstablette eingenommen, um das erste Mal in ihrem Leben ausführlich von ihrem Aufenthalt im Landeserziehungsheim St. Martin in Schwaz zu sprechen. Von den Demütigungen, dem Unrechtsgefühl und der Erziehung zum absoluten Gehorsam. Sie spricht über ihre Kindheit und Jugend, für die sich bis jetzt niemand interessiert hat. „Ich habe so die Wut, so die Wut, so die Wut!“, presst sie heraus. Sie weint, als sie ihren unterdrückten Erinnerungen freien Lauf lässt. Roswitha Lechner hat nicht einmal im Zuge ihrer sechsjährigen Therapie über die großen Wunden, welche die Zeit im Heim ihr geschlagen hat, geredet. „Ich habe wirklich 40 Jahre nie darüber gesprochen. Nun tue ich es für meine verstorbene Schwester.“ (...) Roswitha Lechner und ihre Zwillingsschwester Martha wachsen vaterlos auf, sie sind unzertrennlich. (...)
Die Ankunft: Vorsprechen bei der Direktorin, einer weißhaarigen, noblen Frau. Zwei Erzieherinnen. Gynäkologischer Stuhl. Untersuchung, ob die beiden Mädchen noch Jungfrauen sind. Sofortige Trennung der Zwillinge und somit Verlust der einzigen Bezugsperson. Überziehen der Anstaltskleidung, die für eine äußere Gleichförmigkeit der Zöglinge unter Aufgabe ihrer Individualität sorgt. Gruppeneinteilung. Unterbringung in einem riesigen Schlafsaal mit Spinden und grauen Betten wie beim Militär. Die Wände haben Augen und Ohren. Als Roswitha eine der Erzieherinnen Jahrzehnte danach zufällig auf der Straße sieht, möchte sie diese zur Rede stellen. Doch sie getraut sich nicht. Sie kennt nur ein Gefühl: „Hass, Hass. Ich hätte sie nehmen können und runterschmeißen in den Inn.“ Der Tagesablauf: Zeitig in der Früh aufstehen. Waschen des Intimbereichs nur verstohlen unter dem Nachthemd. Penibel Betten machen, im Gänsemarsch zum Frühstück. In einer Reihe anstehen. Die miserable Kost hinunterwürgen. Fleischlos ist gesund. Wer sich weigert, wird zum Essen gezwungen. Nach dem Mittagessen Spaziergänge im Anstaltsgelände, das mit dicken Mauern von der Außenwelt abgeschirmt ist. Ruhe, Beschaulichkeit und ständige Sprechverbote reglementieren den Alltag. Auch ohne geistliche Schwestern erschallen die klösterlichen Gemäuer durch dutzendfach gemurmelte Hallelujahs. Beten statt denken und diskutieren. Der Kirchenbesuch ist häufig und kann im eintönigen Grau der Wiederkehr des Immergleichen geradezu eine Abwechslung darstellen: Roswitha und Martha haben eine schöne Stimme und dürfen im Chor singen. Arbeit weist den rechten Weg. Daher werden die Zöglinge dauerbeschäftigt.
Arbeiten für ein Taschengeld, das auf ein Heimkonto kommt. Arbeiten, das heißt im Heim putzen, waschen, nähen, sticken, bügeln, Küchenarbeit oder in der Landwirtschaft des Erziehungsheimes. Immer kostenlos oder für ein geringes Entgelt. Mit ihrer Arbeitskraft tragen die Mädchen dazu bei, dass das Heim mit den geringen Tagsätzen der Landesregierung auskommt. Wer brav und folgsam ist, wird belohnt: Nach einem Jahr ist es soweit. Als „kleines Mäuschen, so wie wir es geworden sind“, darf Roswitha nach einem Jahr in den Außendienst gehen. Der ist begehrt, weil er die Isolation, in der sich die Mädchen befinden, durchbricht. Außendienst bedeutet, sich als billige Arbeitskraft zu verdingen. Putzfrau in privaten Haushalten und Betrieben oder Küchengehilfin, Zimmermädchen, Kellnerin. Solcher Art sind die Beschäftigungen. Vielfach sind sie nicht einmal sozialversichert.
Roswitha arbeitet in einer Gastwirtschaft am Achensee und in einem Gasthaus in Schwaz. Dort habe sie auch einige der wenigen schönen Augenblicke erlebt, die sie mit ihrem Heimaufenthalt in St. Martin verbinde: Die Wirtin schenkt ihr ein paar Schuhe, weil sie ihre Bedürftigkeit erkennt. Ein Koch fährt mit ihr und Arbeitskolleginnen mit einem Schiffl am Achensee, sie raucht eine Zigarette. Doch die Bestrafung folgt auf dem Fuß. Jemand habe sie verraten und so sei sie gleich in den Karzer gekommen, also für einige Tage in Isolierhaft. Die weitere Konsequenz: Hintanreihung auf der öffentlich aufgehängten Tafel. Dort sind die Zöglinge ja nach ihrem Wohlverhalten aufgelistet. Die vorderen dürfen außerhalb des hermetisch abgeschirmten Fürsorgeerziehungsheimes als Hilfsarbeiterinnen werken oder sich eines Ausganges erfreuen. Die auf Stunden befristete „Freiheit“ müssen sich die Mädchen erst erarbeiten und entsprechend der Heimordnung verdienen. Eine Lehre wird nach der Absolvierung der heimeigenen einjährigen Hauswirtschaftsschule nur sehr wenigen eröffnet.
Besuche? Erinnerung an einen langen Kellergang mit Tischen; Freude auf ein Wiedersehen mit Oma, die Roswitha gegenübersitzen muss. Wie gerne wäre sie auf ihrem Schoß gesessen und gebusselt worden. „Doch das habe ich mich nicht getraut.“ Zuwendung seitens der Erzieherinnen habe sie nicht erlebt. Wann immer es Begegnungsmöglichkeiten gibt, klammern sich die Zwillinge aneinander. Doch mit der Zeit entfremden sie sich. Nach dem mehr als dreijährigen Heimaufenthalt gestaltet sich ihr Verhältnis nicht mehr so eng wie zuvor. Über die Jahre in St. Martin tauschen sie sich kaum aus: „Nur ja nicht darüber reden. Um Gottes Willen.“ Überhaupt stellt Roswitha Lechner dazu fest: „Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, ich habe viel verdrängt.“ Das traumatischste Erlebnis im Landeserziehungsheim stellt der Selbstmordversuch der Schwester dar. Sie springt aus dem nichtvergitterten Fenster des Festsaals in den Innenhof. Monatelang bleibt Martha bettlägerig, um dann längere Zeit auf Krücken und ein Stützmieder angewiesen zu sein. Nie wieder habe sie sich völlig schmerzlos fortbewegen können. Als besondere seelische Grauamkeit empfindet Roswitha das Verbot, die Zwillingsschwester im Krankenhaus zu besuchen. Sie erfährt nie die genauen Beweggründe von Marthas verhängnisvoller Entscheidung. (...)
Das Verhältnis zu den Mitzöglingen charakterisiert sie, obwohl sie niemanden als echte Freundin bezeichnen würde, als nicht schlecht, auch wenn es an Solidarität gemangelt habe. Für den eigenen Vorteil hätten die Mädchen einander an die Erzieherinnen verraten, was von diesen auch gefördert worden sei. Viele buhlen auf diese Art und Weise aber auch um ihre Gunst und Zuneigung, um Aufmerksamkeit und Zuwendung. Nach einer kurzen Freizeitphase nach dem Abendmahl heißt es früh, ab in die Betten des Massenschlafsaals, der versperrt wird. Licht aus. Mucksmäuschenstill und wieder Ruhe, Abendruhe, Bürgersruhe, Grabesruhe. (...) Wie in einem Gefangenenhaus sei es in St. Martin gewesen, betont sie. Überall zugesperrte Türen. Regeln, Normen, Verbote und Strafen, immer wieder Strafen bei den geringsten Verstößen. Die Heimordnung ist heilig. Daneben sind auch die persönlichen Ordnungsvorstellungen der Erzieherinnen penibelst einzuhalten. Ansonsten: Redeverbot, Schreibverbot, Hofverbot, Ausgehverbot, Arbeitsverbot außerhalb der Anstalt. Weitere Bestrafungen sind Zuteilungen zu verhassten Arbeiten im Heim. Besonders beliebt sind Putzorgien um ihrer selbst willen und natürlich die Verhängung von Karzer als Isolierhaft mit Sprechverbot. „Da bist du katholisch geworden. So ist man unterdrückt worden, psychisch. Man hat nicht schlagen brauchen.“ Auf die Frage, welche Werte den Mädchen vermittelt wurden, bemerkt Roswitha Lechner: „Ein gutes Verhalten für ein Mädchen ist zu folgen. Stillschweigen. Das, was dir gesagt worden ist, umzusetzen und sofort zu folgen und ja nicht aufmucken, ja keinen Widerspruch, ja nicht, und ein gutes Mädchen kann die Hauswirtschaft. Auf eine perfekte Haushaltsführung sind wir vorbereitet worden. Wir haben gelernt, zu putzen, zu kochen, den Tisch zu decken, zu bügeln und zu nähen. Die Frau gehört hinter den Herd, soll ordentlich gekleidet und frisiert sein und sich dem Mann unterordnen.“
Als Summe der dreijährigen „Haft“, so bezeichnet Roswitha Lechner ihren Aufenthalt im Landeserziehungsheim St. Martin in Schwaz, empfindet sie und wiederholt dies mehrere Male im Laufe des Gesprächs: „Hass, auch heute noch. Dass ich zum Jasager geworden bin, dass wenn mich jemand anpfaucht, ich sofort still bin.“ (...) Die Leere umfange sie bis heute: „Manches Mal kommt alles hoch. Ich hasse meinen seelischen Zustand.“ (...) „Ich bin heilfroh, dass ich den Schritt gewagt habe, da bin ich über mich selber hinausgewachsen, dass ich mich traue, Ihnen zu schreiben.“ Roswitha freut sich, dass das Thema in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten ist, dass Missbrauch und Misshandlung beim Namen genannt werden. Das habe ihr Mut verliehen, sich auch als Opfer zu sehen und nicht nur als Schuldige und Minderwertige.