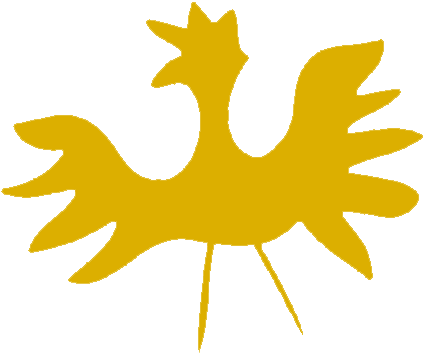Erziehungsziele
In den Einweisungsbegründungen der Jugendämter und Gerichte werden als Ziele der Fürsorgeerziehung das Verhindern des Abgleitens in die Verwahrlosung genannt, weiters sollte einem bereits fortgeschrittenen Verwahrlosungsprozess Einhalt geboten werden, um aus dem Kind und Jugendlichen (wieder) ein „brauchbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft“ zu machen. Es ging also darum, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft einnahmen: als fleißige Arbeitskraft, Mutter, Haus- und Ehefrau, als erwerbsarbeitender Familienernährer. Und sie sollten die gesetzlichen Vorschriften und die herrschenden Sexualnormen einhalten. Also, ein bürgerliches Leben führen.
„Totale Institutionen“
Die Heime waren als „totale Institutionen“ organisiert. Die innere Organisation bestimmte den Alltag der InsassInnen, für die eine billige Massenerziehung vorgesehen war. Das Leben im Heim war völlig bürokratisiert: Die Heimstruktur regelte die Beziehungen und jede Verhaltensmöglichkeit. Die HeimbewohnerInnen waren im höchsten Maße fremdbestimmt. Die Aufrechterhaltung des Massenbetriebes unter dem Vorzeichen eines überaus schlechten Betreuungsschlüssels hatte oberste Priorität, dem sich alle und alles unterzuordnen hatten. Bei Entscheidungen, die sie betrafen, wurden die Zöglinge nicht miteinbezogen. Die Kinder- und Fürsorgeheime stellten selbst den Anspruch, eine „familienähnliche“ Ersatzerziehung durchzuführen. Dennoch wurden im Widerspruch dazu die Kinder und Jugendlichen nach dem Geschlecht in getrennte Heime gebracht oder in getrennte Häuser eines weitläufigen Heimareals einquartiert. Die altersmäßige Gruppeneinteilung war nicht nur familien-, sondern auch weltfremd. Der Familienanspruch der Ersatzerziehung wurde nicht erfüllt.
Die Heime waren bereits durch ihre Bauweise und zumeist aufgrund ihres abgelegenen Standortes von der Außenwelt abgeriegelt. In die Stadt, ins Dorf und in Kontakt mit Gleichaltrigen kamen die Kinder und Jugendlichen kaum, auch die Beschulung fand mehrheitlich separiert statt. Noch 1995 wurden die Heimkinder der Bubenburg in Fügen „die Geschlossenen“ genannt.
Alle Lebensäußerungen der InsassInnen, wie in die Schule gehen, arbeiten, wohnen, essen, kommunizieren und spielen, fanden in der Regel an einem Ort, im Heim, statt. Die Möglichkeit, soziale Erfahrungen zu machen und Beziehungen einzugehen, waren dadurch massiv eingeschränkt. Die Kinder konnten sich nicht in einem anderen sozialen Raum erleben, als jemand anderer, mit einer vielfältigen Identität, mit einem anderen Blick der Umwelt auf sie als jener, der im Heim auf sie gerichtet war.
Die räumliche Isolierung enthüllt den eigentlichen Charakter der Heime als Schutzeinrichtungen der Gesellschaft vor verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Sie wurden weggesperrt wie die TrägerInnen einer ansteckenden Krankheit. Das konnte weder eine Vorbereitung auf das Leben noch ein geeignetes Mittel für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft sein.
Auch die materielle Ausstattung war dürftig, kinder- und jugendunfreundlich, unpersönlich-entpersönlichend, freudlos, nüchtern-zweckmäßig und angstmachend. Der gesamte Tagesablauf, alle Aktivitäten und Beziehungen waren bis ins Letzte geplant und normiert. Die Richtung war vorgegeben: Regel – Beurteilung – Strafe, selten Belohnung. Wer sich nicht anpasste, wurde zum ständigen Opfer dieses Systems. Die Artikulation von eigenen Wünschen und Bedürfnissen war ebenso wenig vorgesehen wie Selbstständigkeit, Probehandeln, Mündigkeit, Partizipation oder Demokratie. Jeder Versuch in diesem Sinne wurde als Aufbegehren, Widerspenstigkeit und Renitenz gewertet, kurz, als Regelverstoß, der zu ahnden war. Ausschlaggebend war nicht, was das Kind konnte und gut machte, sondern was es nicht konnte und nicht gut machte.
Die streng nach Stärke und Schwäche aufgebaute Heimhierarchie förderte die Gewalt des Personals gegenüber den Heranwachsenden, aber auch zwischen ihnen. Kinder und Jugendliche quälten, demütigten, schlugen und missbrauchten sexuell andere Kinder und Jugendliche. Die Opfer konnten meist auf keine Unterstützung durch die Erwachsenen hoffen. Teils standen die Heimleitungen und ErzieherInnen dem Geschehen gleichgültig gegenüber, verhielten sich passiv und sahen tatenlos zu. Teils förderten sie die Übergriffe unter den Heranwachsenden und benutzten sie unter Androhung von Strafen für die Ausführung von Demütigungs- und Schlagritualen. In einigen Heimen kann von einem Kapo-ähnlichen System gesprochen werden.
Schutz der bürgerlichen Gesellschaft
„Totale Institutionen“ wie das Heim etablierten einen Prozess des Ausschlusses (Exklusion) sozial deklassierter Kinder und Jugendlichen, der eine hohe Wahrscheinlichkeit der Deformierung des Selbst mit einschloss. Weggesperrt und isoliert von der Außenwelt erfuhren die Zöglinge ihre Stigmatisierung, die sie zeit ihres Lebens mit sich trugen. Die Fürsorgeheime hatten als Kontrollinstanzen das Wohlergehen der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern. Sie fungierten zu deren Schutz vor den missratenen und verwahrlosten Kindern und Jugendlichen aus den Unterschichten, die als Gefahr für die soziale Ordnung, das heißt für die kleinbürgerlich-katholische Ordnung gesehen wurden. Es ging um die Aufrechterhaltung von Arbeit(spflicht), Eigentum(sverhältnissen) und bürgerlichem Sexualverständnis, der Kleinfamilie und der patriarchalen Geschlechterrollen und Geschlechterverhältnisse.
Psychiatrische Diagnosen, Führungsberichte der Heime, Aktenvermerke der Jugendämter, Schülerbeschreibungsbögen, Bescheide von Gerichten, aber auch das Zusammenspiel von Politik und Kirche legitimierten als behördliche Verfahren diesen Prozess des Ausschlusses der Kinder. Das System Heim war also systematisch eingebunden in ein dichtes Institutionennetz. Verschiedene Apparate arbeiteten zusammen, um den ihrer Meinung nach gesellschaftsgefährdenden Kindern aus der Unterschicht Einhalt zu gebieten. Diese erschienen als gesellschaftliche Belastung, als „entbehrliche“ Wesen, deren Defizite und Defekte verhinderten, dass sie für die Allgemeinheit nützlich waren; als „Überflüssige“ wurden sie wahrgenommen, da sie auf Dauer von Versorgung und Unterstützung abhängig zu bleiben drohten.
Erziehung zur Mutter und zum fleiSSig arbeitenden Familienernährer
Geschlechtsspezifisch waren die Mädchen und jungen Frauen auf die Gründung einer Familie vorzubereiten und mit den damit verbundenen Kompetenzen und Haltungen (Haushaltsführung, Gesundheitsbewusstsein, sexuelle Treue, Fürsorglichkeit) auszustatten. Generell ging es um eine Verhäuslichung der weiblichen Heranwachsenden. Erstes Ziel bei den Burschen war die Herausbildung einer positiven Arbeitseinstellung.
Die Berufsorientierung war in den Heimen für die männliche Jugend weitaus höher als für die weibliche. Zumindest eine Heranführung an eine Berufsarbeit wurde angestrebt, oft waren es dennoch nur Hilfsarbeiten oder eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Die Ausbildung der weiblichen Zöglinge war von vorneherein viel stärker auf weibliche Hilfstätigkeiten ausgerichtet. Hier wirkte neben der Familienideologie die traditionelle Hinführung der weiblichen Heimkinder auf den Dienstbotenberuf nach. Das Tiroler Landeserziehungsheim Schwaz bot intern vor allem Tätigkeiten in der Küche und Wäscherei sowie im Bügel- und Nähzimmer an. Die „Braven“ durften außerhalb der Anstaltsmauern in der Gastronomie, im Tourismus und in sonstigen weiblichen Traditionsberufen tätig werden, die schlecht bezahlt waren und kaum Aufstiegschancen boten. Eine berufliche Qualifizierung, die den Status der Jugendlichen gegenüber jenem vor ihrer Einlieferung verbessert hätte, wurde nicht angestrebt. Das Prinzip der Erziehung zur Arbeit durch Arbeit nahm Ausmaße jenseits des Vertretbaren an. Bereits in den Kinderheimen und nicht nur in Fürsorgeerziehungsheimen ist von Zwang zur Arbeit und von Ausbeutung durch Arbeit zu sprechen. Bildung und Ausbildung traten demgemäß in den Hintergrund.
Auch wenn es nicht primäres Ziel der Heime war, so sorgten sie in der Realität für die Bereitstellung billiger Arbeitskräfte für die krisengeschüttelte Landwirtschaft und einen Arbeitsmarkt, der noch einen hohen Bedarf an HilfsarbeiterInnen hatte. Eine Reihe ehemaliger Zöglinge klagt, dass sie nicht sozialversichert waren, im Heim zum größten Teil gratis arbeiten hätten müssen und dass sie über ihr selbstverdientes Geld nicht frei verfügen durften. Sie hatten Demutsgesten an den Tag zu legen, um Zugriff zum eigenen, hart verdienten Geld zu haben. Für die von Haus aus materiell unterprivilegierten Heimkinder hatte Eigentum eine besonders große Bedeutung. Neben dem Zugang zur materiellen Welt, die ihnen aufgrund ihrer Herkunft verschlossen war, war die Verfügung über einen Besitz, und sei er noch so klein, mit einem Gefühl von Würde verbunden und ein wesentlicher Teil ihrer Identitätsausstattung. Doch im Heim wurde ihnen alles genommen.
Sekundärtugenden
Die Erziehungsprinzipien hatten sich seit der Monarchie wenig geändert: Ordnung, innere und äußere Sauberkeit, Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Sparsamkeit, Selbstdisziplin und vor allem Gehorsam galten für beide Geschlechter. In den geistlichen Anstalten, teils auch in den weltlichen, ging es weiters um die Verankerung der katholischen Religion und ihrer Moralvorstellungen. Die rigiden Erziehungsmethoden sollten dazu führen, dass die erfahrenen Zwänge verinnerlicht wurden, sodass die Kinder und Jugendlichen gemäß den gesellschaftlichen Erwartungshaltungen wieder funktionierten. Es ging um Korrektur und Reparatur. Im Grunde genommen waren Heime Strafanstalten, getarnt als Erziehungsunternehmen. In den Heimen gab es weder ein pädagogisches Konzept noch ein therapeutisches Angebot. Die permanente, exzessive Gewalt und die demütigenden Unterwerfungspraktiken verhinderten die angestrebte Verinnerlichung einer bürgerlichen Lebensführung. Letztendlich war die Heimerziehung in der Praxis irrational und kontraproduktiv, plan- und ziellos.